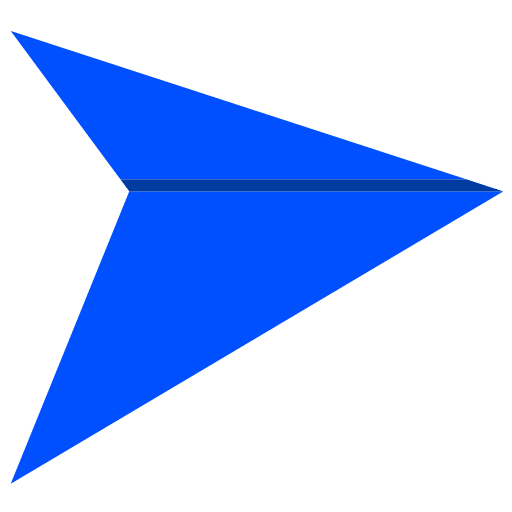[WERBUNG] Fehlerhafte Prüfungsbewertung, Plagiatsvorwurf oder Täuschungsverdacht – wer in der Schweiz eine Prüfung ablegt, kann schnell in rechtliche Konflikte geraten. Gerade im Bildungsrecht gibt es viele Unsicherheiten und Mythen.
Dabei sind die Rechte der Studierenden klar geregelt: Von der Matura bis zur Facharztprüfung können Entscheidungen rechtlich überprüft und erfolgreich angefochten werden. Die Spezialisten für Prüfungsrecht in der Schweiz – Rechtsanwälte Dr. Heinze & Partner vertreten Mandanten schweizweit, verfügen über wissenschaftliche Expertise und langjährige Erfahrung in Prüfungsanfechtungen.
Dr. Heinze & Partner sind die wohl führende internationale Kanzlei für Bildungsrecht mit den meisten im Prüfungsrecht tätigen Rechtsanwälten. Im Interview erklärt Rechtsanwalt Dr. Arne-Patrik Heinze, welche Chancen ein Rechtsmittel bietet, welche Irrtümer sich hartnäckig halten – und welche Rolle moderne Themen wie KI und Täuschungsvorwürfe heute im Prüfungsrecht spielen.
Allgemeines zum Prüfungsrecht
1. Herr Dr. Heinze, welche Bedeutung hat das Prüfungsrecht im Bildungssystem der Schweiz und inwiefern unterscheidet es sich von Deutschland?
Mit dem Prüfungsrecht wird die Chancengleichheit im Bildungssystem gesichert. In der Schweiz sind Einsprache, Rekurs und Beschwerde die zentralen aussergerichtlichen Rechtsbehelfe. In Deutschland ist das der Widerspruch und es gibt gelegentlich auch die Remonstration. Die Grundprinzipien sind vergleichbar, aber die Verfahren sind unterschiedlich ausgestaltet.
2. Welche Prüfungen können angefochten werden – gilt das gleichermaßen für Schule, Hochschule und Berufsexamina?
Prüfungsanfechtungen sind grundsätzlich bei allen Prüfungen möglich: von der Matura über Bachelor- und Masterprüfungen bis zu Eidgenössischen Fachprüfungen. Dabei ist es irrelevant, ob Prüfungen online oder analog erfolgen.
3. Welche rechtlichen Grundlagen regeln Prüfungsanfechtungen in der Schweiz und welche in Deutschland?
In der Schweiz gibt es kantonale Gesetze und Prüfungsreglements in den Kantonen und eigenständige Regelungen auf Bundesebene. Die konkret anwendbaren Regelungen hängen unter anderem von der jeweiligen Prüfung ab.
In Deutschland gelten die jeweiligen Landesgesetze, Satzungen und Verordnungen auf Landesebene sowie entsprechende Regelungen auf Bundesebene. In der Schweiz und in Deutschland sind zudem die jeweiligen Verfassungen mit Grundrechten massgeblich. Gemeinsam ist beiden Rechtsordnungen insoweit das Gebot der Chancengleichheit und das Recht auf rechtliches Gehör.
4. Welche häufigen Irrtümer begegnen Ihnen in Ihrer Praxis, wenn Studierende über Prüfungsanfechtungen sprechen?
Viele glauben, dass eine schlechte Note nicht angreifbar sei. Tatsächlich ist entscheidend, ob Verfahrens- bzw. Bewertungsfehler gegeben sind. Ein weiterer Irrtum ist, dass gesetzliche Fristen großzügig ausgelegt bzw. beliebig verlängert werden können – das Gegenteil ist der Fall, sie sind in der Regel streng einzuhalten.
Ein weiterer Irrtum ist, dass eine Prüfungsanfechtung mit ChatGPT oder einem anderen Large Language Model auch nur ansatzweise professionell bearbeitet werden kann. Bei der Verwendung einer KI im Prüfungsrecht kommt weitestgehend Unbrauchbares heraus. Das verwundert nicht, da eine KI lediglich so genannte Token auf der Basis der Wahrscheinlichkeitsrechnung zusammensetzt.
Ablauf & Chancen einer Prüfungsanfechtung
1. Welche Fehler in Prüfungsverfahren führen häufig zu einer erfolgreichen Anfechtung?
Typisch sind fachliche Bewertungsfehler, fehlende Transparenz bei Bewertungskriterien oder formale Aspekte wie Lärm im Prüfungsraum. Auch gesundheitliche Einschränkungen, die nicht berücksichtigt wurden, können entscheidend sein.
2. Wie läuft ein Rekurs oder eine Beschwerde gegen eine Prüfungsentscheidung in der Schweiz konkret ab und wie ist das Verfahren in Deutschland ausgestaltet?
In der Schweiz werden Einsprache, Rekurs bzw. Beschwerde schriftlich bei der zuständigen Behörde eingereicht. In der Regel ist die Begründung innerhalb der Frist zu verfassen, da die Behörden mit der Verlängerung der Begründungsfristen in der Schweiz (rechtswidrig) sehr restriktiv umgehen. Dadurch kann das Verfahren erschwert werden, weil es immer wieder vorkommt, dass Behörden die Akten spät oder nicht zur Verfügung stellen, um effektiven Rechtsschutz zu vereiteln.
Insoweit haben wir ein Musterverfahren beim EGMR (Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte) in die Wege geleitet, um den gebotenen Rechtsschutz zu stärken. Lustig ist, dass die Kommunikation im Verwaltungsrecht in der Schweiz bei kantonalen Rechtsbehelfen im Jahr 2025 in der Regel tatsächlich noch mit der analogen Post erfolgt. Deutschland ist mit seinem schlecht aufgesetzten elektronischen System beA schon miserabel aufgestellt. Die Schweiz toppt dies tatsächlich noch. Postversand im Jahr 2025 ist unglaublich.
In Deutschland ist regelmäßig der Widerspruch der erste Rechtsbehelf, soweit er nicht entbehrlich ist. Anders als in der Schweiz, sind die Fristen für Begründungen der Rechtsbehelfe (nicht für die Erhebung der Rechtsbehelfe) in der Regel verlängerbar. Nach dem behördlichen Verfahren ist in der Regel eine Klage möglich und der Rechtsweg durch die Instanzen ist eröffnet. Es gibt allerdings in beiden Ländern auch zivilrechtliche Prüfungsanfechtungen gegenüber privaten Bildungsträgern, die anders verlaufen.
3. Welche Rolle spielen Verfahrensfehler, zum Beispiel der Prüfungsaufsicht?
Verfahrensfehler sind in der Schweiz oft der Kern einer Prüfungsanfechtung. Wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurden, kann dies zur Aufhebung einer Entscheidung führen. Wichtig ist in der Regel eine sofortige Rüge der Verfahrensfehler. Bezüglich der Beweisaufnahme ist das Engagement der Gerichte noch ausbaufähig. Es sollte mehr Zeugenvernehmungen usw. geben.
4. Wie hoch sind die Chancen auf Erfolg bei einer Prüfungsanfechtung und welche Unterschiede gibt es zwischen Schweiz und Deutschland?
Die Chancen hängen vom Einzelfall ab und lassen sich nicht pauschal benennen. Je klarer ein Verfahrens- bzw. Bewertungsfehler erkennbar ist, desto höher sind die Chancen auf eine erfolgreiche Prüfungsanfechtung.
In vielen Verfahren können Erfolge erzielt werden. Unterschiede in Deutschland und der Schweiz bestehen weniger in den Erfolgsaussichten, als vielmehr in der Ausgestaltung des Verfahrenswegs und der Beachtung rechtsstaatlicher Grundsätze. Tendenziell erscheinen deutsche Verwaltungsgerichte weniger obrigkeitshörig, zumal im deutschen Verwaltungsrecht der Amtsermittlungsgrundsatz gilt und oft auch ernst genommen wird.
Plagiat & Täuschungsversuch
1. Was bedeutet eine Prüfungsanfechtung wegen eines Plagiatsvorwurfes konkret?
Ein Plagiatsvorwurf ist zum Beispiel gegeben, wenn fremdes Gedankengut ohne Quellenangabe übernommen wurde. Es gibt verschiedene Plagiate wie zum Beispiel ein paraphrasierendes Plagiat, ein Übersetzungsplagiat und ein Strukturplagiat. In den Verfahren geht es oft darum, ob es sich tatsächlich um ein prüfungsrechtliches Plagiat oder lediglich um unpräzises wissenschaftliches Arbeiten handelt.
2. Welche Möglichkeiten haben Studierende, sich gegen den Vorwurf eines Täuschungsversuchs zu wehren – etwa bei unerlaubten Hilfsmitteln oder formalen Fehlern?
Studierende können verlangen, dass die Prüfungsinstitution einen Anscheinsbeweis für den Täuschungsversuch erbringt. Oft fehlt dieser oder basiert auf unsicheren Annahmen.
3. Wie unterscheiden sich Täuschungsvorwürfe im schulischen Bereich von jenen an Universitäten?
Im Schulrecht geht es häufig um formale Verstöße, während es an Universitäten nicht selten wissenschaftliche Standards im Vordergrund stehen.
4. Können Vorwürfe wie Plagiat oder Täuschungsversuch auch dann erfolgreich angefochten werden, wenn KI-Tools oder Chatbots (z. B. ChatGPT oder Gemini) genutzt wurden?
Ja, denn die Nutzung einer KI ist nicht automatisch als Täuschungsversuch zu bewerten. Entscheidend ist, ob die Prüfungsordnung deren Einsatz verbietet, wie die KI eingesetzt wurde und ob von der Prüfungseinrichtung ein Anscheinsbeweis erbracht wurde.
5. Welche rechtlichen Maßstäbe gelten aktuell, wenn eine Hochschule behauptet, eine Prüfungsleistung sei mithilfe einer KI entstanden?
Die Hochschule muss den Vorwurf mittels eines Anscheinsbeweises belegen. KI-Detektionssoftware liefert oft keine gerichtsfesten Nachweise, sodass bloße Verdachtsmomente nicht genügen.
6. Gibt es bereits konkrete Fälle in der Schweiz oder in Deutschland, in denen KI im Zentrum einer Prüfungsanfechtung stand?
Ja, wir erleben permanent Fälle, in denen eine KI-Nutzung unterstellt wird. Häufig fehlt es aber an klaren Anscheinsbeweisen, sodass die Vorwürfe nicht haltbar sind.
Praktische Tipps & Unterstützung
1. Welche Unterlagen und Beweise sind bei einem Prüfungsrekurs besonders wichtig?
Entscheidend sind die Prüfungsakten, Bewertungsvoten, Aufzeichnungen aus der Prüfungssituation, gegebenenfalls medizinische Atteste und Video- oder Tonaufzeichnungen.
2. Welche Fehler machen Betroffene oft, wenn sie versuchen, ohne anwaltliche Hilfe Rekurs einzulegen?
Häufig werden Fristen versäumt und es fehlt selbstverständlich an juristischer Expertise, so dass die juristische Einordnung, die für den Erfolg notwendig ist, nicht erfolgt. Besonders schlecht gelingen meist Versuche, eine Prüfungsanfechtung mittels ChatGPT oder anderen Sprachmodellen durchzuführen. Es würde wohl auch kaum jemand auf die Idee kommen, anstatt einen Zahnarzt aufzusuchen, selbst die Schlagbohrmaschine am Zahn anzusetzen. Es können irreparable Schäden entstehen.
3. Warum ist es sinnvoll, sich an eine spezialisierte Kanzlei wie Dr. Heinze & Partner zu wenden – gerade weil Sie sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland Standorte haben?
Wir kennen die Besonderheiten beider Rechtsordnungen und können dadurch grenzübergreifend beraten. Zudem verfügen wir über wissenschaftliche Publikationen und Erfahrung aus wissenschaftlicher Lehrtätigkeit. Die Rechtsanwälte Dr. Heinze & Partner haben in all den Jahren als Spezialisten für Prüfungsrecht viele tausende Verfahren geführt und viele Erfolge erzielt.
4. Welche Kosten entstehen bei einer Prüfungsanfechtung, und wie ist die Kostenregelung im Erfolgsfall?
Die Kosten variieren je nach Verfahren und Instanz. In der Schweiz muss man mit mehreren tausend Franken rechnen. Im Erfolgsfall können Kosten ganz oder teilweise von der Prüfungsinstitution übernommen werden.
5. Welche positiven Auswirkungen kann eine erfolgreiche Anfechtung auf die akademische oder berufliche Laufbahn haben?
Eine erfolgreiche Prüfungsanfechtung ermöglicht die Fortsetzung der Ausbildung, schützt vor ungerechtfertigten Karrierehindernissen und bewahrt das Vertrauen in das Prüfungswesen. Sie kann zukunftsentscheidend sein.
6. Was raten Sie Studierenden und Berufsanwärtern, die gerade mit einem Täuschungsvorwurf oder einer nicht bestandenen Prüfung konfrontiert sind?
Sie sollten sich sofort rechtliche Beratung suchen und keine übereilten Eingeständnisse machen. Jede Stellungnahme kann später entscheidend sein.
Fazit
Das Interview macht deutlich: Das Prüfungsrecht in der Schweiz bietet Studierenden und Berufsanwärtern echte Chancen, sich gegen ungerechtfertigte Bewertungen, Plagiatsvorwürfe oder einen Täuschungsverdacht zu wehren. Gerade in Zeiten, in denen auch KI-Tools und digitale Prüfungsformate neue Unsicherheiten schaffen, ist die Expertise von auf Bildungsrecht spezialisierten Kanzleien wie Dr. Heinze & Partner entscheidend. Die Kanzlei kombiniert wissenschaftliche Reputation, langjährige Praxiserfahrung, strategisches Vorgehen und gibt damit Betroffenen die Möglichkeit, ihre Rechte konsequent durchzusetzen und ihre Ausbildung erfolgreich fortzusetzen.
Auch in Deutschland sind Dr. Heinze und Partner mit Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Köln und München aktiv. Prüfungsanfechtungen an Universitäten, Fachhochschulen oder Berufskammern folgen hier eigenen rechtlichen Grundlagen, weisen aber ähnliche Fallkonstellationen auf: von Bewertungsfehlern über Plagiatsvorwürfe bis hin zu Täuschungsvorwürfen im Zusammenhang mit KI. Durch ihre Doppelkompetenz in beiden Rechtsordnungen sind Dr. Heinze & Partner grenzübergreifend im Bildungsrecht tätig, ein klarer Vorteil für Studierende, die in beiden Ländern Prüfungen ablegen, Anerkennungsverfahren durchlaufen oder zum Beispiel Probleme mit dem IB haben.